
Redaktion – 18. März 2025
Der zunehmende Pessimismus in unserer Gesellschaft hat seine Wurzeln in der Krise des Kapitalismus. Besonders betroffen ist das Kleinbürgertum, also kleine Selbstständige, Handwerker und Ladenbesitzer. Diese Menschen fürchten die Zukunft, weil sie wirtschaftlich immer stärker unter Druck geraten. In schwierigen Zeiten, insbesondere in einem imperialistischen Krieg, trifft es diese Gruppe oft als Erste. Sie steht der Arbeiterklasse näher als anderen gesellschaftlichen Schichten, weshalb ihre Sorgen und Unsicherheiten sich oft in der gesamten Gesellschaft widerspiegeln.
.
Die Krise der bürgerlichen Gesellschaft im Imperialismus
Obwohl der Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft im Imperialismus immer deutlicher wird, erkennen bürgerliche Ideologen, die das Private verteidigen, diese Entwicklung nicht in vollem Umfang. Die bürgerliche Ideologie ist dazu gezwungen, innerhalb eines Systems der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft zu verbleiben, ohne eine neue Gesellschaftsordnung zu schaffen. Statt nach Lösungen für die leidende Bevölkerungsmehrheit zu suchen, bietet sie lediglich eine Beteiligung an den bestehenden kapitalistischen Verhältnissen an – zum Nachteil der Mehrheit.
Besonders absurd wird diese Situation, wenn die bürgerliche Ordnung umso stärker verteidigt wird, je näher sie ihrem eigenen Untergang kommt. Dies zeigt sich in allgemeiner Verzweiflung: der Angst vor einer düsteren Zukunft, dem Zerfall sozialer Strukturen und dem verzweifelten Versuch, das Unaufhaltsame doch noch aufzuhalten. Diese Haltung gleicht einer Verschwörung von Bildung und Besitz gegen die Naturgesetze und die gesellschaftliche Entwicklung. Eine Gesellschaftsordnung, die ihrem Ende entgegengeht, zeigt oft ein letztes, verzweifeltes Aufbäumen. So auch der Kapitalismus: Seine aufstrebende Phase und seine Blütezeit liegen hinter ihm, und im Imperialismus bewegt er sich unaufhaltsam seinem Niedergang entgegen.
.
Imperialismus und seine zerstörerische Dynamik
Als die Bourgeoisie einst aufstieg, formulierte Hegel 1818 in Berlin, dass sich das Universum dem menschlichen Forschergeist nicht verschließen könne. Doch heute bietet der Imperialismus den Völkern nichts mehr, das es zu erforschen oder zu genießen gibt. Stattdessen bringt er Weltkriege, Neuaufteilungen bereits verteilter Gebiete, Bürgerkriege und Naturkatastrophen ungekannten Ausmaßes. Hinzu kommt die Gefahr der totalen Zerstörung durch Atomwaffen. Der Imperialismus strebt nach Weltherrschaft, und Krieg ist seine natürliche Fortsetzung.¹
Im Imperialismus besteht die Möglichkeit einer totalen Politisierung aller Lebensbereiche. Dies führt entweder zur völligen Entpolitisierung der Gesellschaft oder zu ihrer revolutionären Umgestaltung. Karl Marx schrieb: „Die Revolution überhaupt – der Umsturz der bestehenden Gewalt und die Auflösung der alten Verhältnisse – ist ein politischer Akt. Ohne Revolution kann der Sozialismus nicht verwirklicht werden.“² Dies ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit: Der Sturz der herrschenden Klasse ist Voraussetzung für die Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Doch hier endet das Denken der Bourgeoisie. Sie steht vor einer ausweglosen Situation und ist unfähig, eine Perspektive zu entwickeln. Die Mehrheit des Volkes unter Führung der Kommunistischen Partei muss den Ausweg finden – und unter den Bedingungen des Imperialismus kann dies nur gewaltsam geschehen.
.
Der Weg des Proletariats zur Befreiung
Die Existenz der bürgerlichen Republiken verdanken diese einzig dem Fleiß der Arbeiter und Bauern – und im Krieg ihrem Heldenmut. Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt bereits den Weg zum Sozialismus: Die Monopole, die Vergesellschaftung der Arbeit und die Zentralisierung der Wirtschaft legen seine Grundlagen. Friedrich Engels betonte, dass das Proletariat die Bourgeoisie an ihren eigenen Versprechen messen muss. Die herrschende Klasse sieht oft nur noch einen Ausweg: den Verfassungsbruch.
Das Proletariat, die armen Kleinbauern, die Gelegenheitsarbeiter in den Städten und die Tagelöhner auf dem Land dürfen ihre soziale Herkunft nicht vergessen. Ein klares Klassenbewusstsein ist entscheidend. Die vom Kapital Unterdrückten haben einen gesunden Instinkt dafür entwickelt, wer zu welcher Klasse gehört. Während eine untergehende Klasse nur noch destruktiv handelt, ist eine sich befreiende Klasse von kreativer Zerstörung geprägt. Nur Klassen, die auf die Zukunft gerichtet sind, können die richtige politische Haltung entwickeln. Karl Marx schrieb: „In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit nur ein Mittel, um die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft ist die aufgehäufte Arbeit nur ein Mittel, um das Leben der Arbeiter zu verbessern.“³
Marx und Engels kritisierten bereits die Feudalsozialisten als unfähig, den Lauf der Geschichte zu begreifen.⁴ Der Marxismus-Leninismus erkennt die objektive Realität an und geht davon aus, dass sich menschliches Wissen beständig erweitert. Weder Natur noch Gesellschaft entwickeln sich willkürlich. Schon die aufstrebende Bourgeoisie musste gegen die Feudalideologie kämpfen. Thomas von Aquin behauptete, die Natur sei unbestimmt, während Galileo Galilei ihre Gesetzmäßigkeiten verteidigte. Marx und Engels zeigten, dass auch die gesellschaftliche Entwicklung bestimmten Gesetzen folgt. Wer diese versteht, kann die Zukunft besser voraussehen.
Eine wissenschaftliche Weltanschauung beruht auf zwei Grundlagen: der materialistischen Theorie und der dialektischen Methode. Der Idealismus glaubt an einen äußeren Anstoß, während der Materialismus davon ausgeht, dass sich Entwicklungen aus inneren Widersprüchen ergeben. Lenin definierte die Dialektik als Methode zur Erforschung dieser Widersprüche, um die Welt korrekt widerzuspiegeln. Dennoch lässt sich die Zukunft nicht bis ins kleinste Detail vorhersagen: „Es wäre lächerlich, die genauen Formen und Daten der künftigen Schritte der Revolution voraussagen zu wollen.“⁵
Während Vertreter der alten Ordnung die progressive Kraft der Volksmassen ignorieren, setzen Marxisten-Leninisten gerade auf sie. Kein Expertenzirkel kann mit der Erfahrung und dem Wissen der Massen mithalten. Wissenschaft ist immer kollektiv – und ohne das Wissen der Massen gibt es keine konkreten Zukunftsperspektiven.
Hegel und Marx maßen der Wissenschaft hohe Bedeutung bei. Doch während Hegel glaubte, die Geschichte sei bereits abgeschlossen, erkannte Marx, dass sie weitergeht. Besonders deutlich wird dieser Unterschied in der Staatsfrage. Hegel, als Idealist, sah in der preußischen Monarchie den Höhepunkt der Geschichte. Marx hingegen erkannte, dass die industrielle Revolution die Produktionsmöglichkeiten ins Unendliche gesteigert hat. Er schrieb: „Die große Industrie schuf in der Dampfmaschine und den übrigen Maschinen die Mittel, die industrielle Produktion in kurzer Zeit und mit wenig Kosten ins Unendliche zu vermehren.“⁶
- Vergleiche Lenin: Über eine Karikatur auf den Marxismus, Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 26.
- Karl Marx: Kritische Randglossen zu dem Artikel eines Preußen, Werke, Band 1, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 409.
- Karl Marx: Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke, Band 4, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 476.
- a.O., Seite 483.
- Lenin: Der Sieg der Kadetten und die Aufgaben der Arbeiterpartei, Werke, Band 10, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 273.
- Friedrich Engels: Grundsätze des Kommunismus, Werke, Band 4, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 369.
.
Lest die Klassiker und studiert den Marxismus-Leninismus!
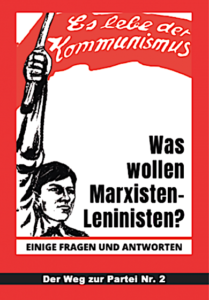 |
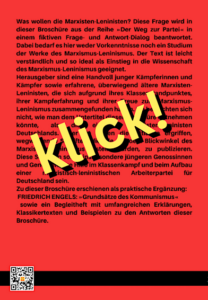 |
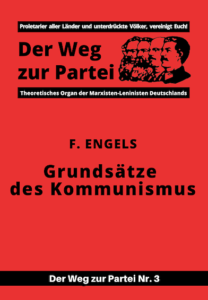 |
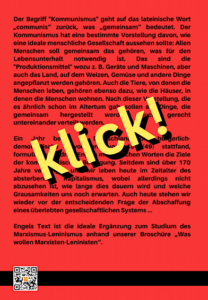 |
|
| bestellen | LESEPROBE | …. | bestellen | LESEPROBE |
.
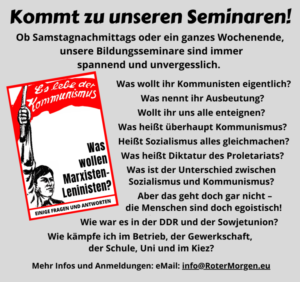 Kontakt: Info@RoterMorgen.eu
Kontakt: Info@RoterMorgen.eu
.
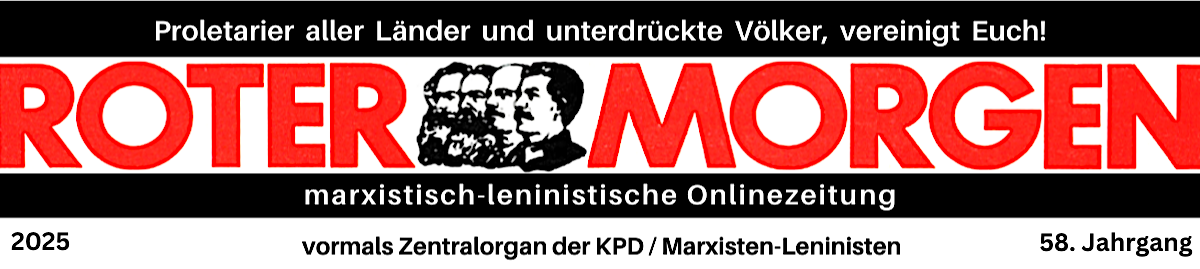
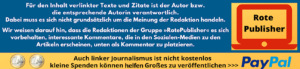
Antworten