
Volkskorrespondenz zum Wochenede
Heinz Ahlreip – 11. Juli 2025

Lenin bemerkt 1913 zum Briefwechsel von Marx und Engels Folgendes: „Versucht man mit einem Wort auszudrücken, was sozusagen den Brennpunkt des ganzen Briefwechsels ausmacht, jenen zentralen Punkt, in dem alle Fäden des Netzes der geäußerten und erörterten Ideen zusammenlaufen, so wird dies das Wort Dialektik sein. Die Anwendung der materialistischen Dialektik bei der radikalen Umarbeitung der gesamten politischen Ökonomie, ihre Anwendung auf die Geschichte, auf die Naturwissenschaft, die Philosophie, die Politik und die Taktik der Arbeiterklasse – das ist es, was Marx und Engels vor allem interessiert, hierzu haben sie das Wesentlichste und Neueste beigetragen, das ist der geniale Schritt, den sie in der Geschichte des revolutionären Denkens vorwärts getan haben.“¹
So kommentiert Lenin, hier auszugsweise, den gesamten, uns vorliegenden Briefwechsel zwischen Marx und Engels. Die Betonung liegt dabei darauf, dass beide eine materialistische Dialektik ausgearbeitet hatten. Mit der idealistischen Dialektik ist es nicht möglich, eine radikale, revolutionäre Umwälzung einer im Idealismus befangen bleibenden bürgerlichen Ideologie durchzusetzen. Im Gegenteil, Marx betont am 24. Januar 1873 im Nachwort zur zweiten Auflage des Kapitals ausdrücklich, dass eine idealistische Dialektik sich passiv zur Wirklichkeit verhält.² Die Anerkennung der bestehenden Klassengesellschaft ist gleichbedeutend mit der Anerkennung der bestehenden kernspalterischen Personenkonstellation: als Lohnsklave oder als Ausbeuter menschlicher Arbeitskraft. Neben den Proletariern und den Kapitalisten existieren in der modernen bürgerlichen Gesellschaft noch die Bauern und die nichtproletarischen Massen. Das Sich-Nichtabfinden mit dem Vorliegenden ist Grundbedingung der Überwindung einer in Klassen gespaltenen Gesellschaft und Grundbedingung des Erfechtens menschlicher Verhältnisse, in denen die arbeitenden Menschen sich als Menschen wiederfinden werden. Wer das Gegenwärtige perspektivlos schluckt, wird von ihm gnadenlos verschluckt. Neue Ideen tauchen auf, will sagen: In einer alten Gesellschaft haben sich Elemente einer neuen gebildet.³ Immer reflektiert sich in der geistigen Produktion einer Epoche Altes und Neues, Reaktion und Fortschritt, Revolution und Konterrevolution.
Akzeptanz der Lohnarbeit als konstant-alternativlos, gar als Gipfel der Zivilisation, ist gleichbedeutend mit Abweisung einer zukünftigen humanen Weltgestaltung, ist gleichbedeutend dem animalischen Kauern in der staatlichen Höhle bzw. Hölle des Sklaventums. So sind heute unweigerlich die Weichen der Geschichte gestellt. Der Imperialismus, gestern und heute gesteigert, ist destruktiv-kriegerisch ausgerichtet, er kann nicht zurück, er potenziert sich gerade ins Weltkriegerische, hier in eine neue Dimension hinein. Wer aus dem irrational-imperialistischen Dekadenzverderben heraus als Wende in ihm selbst eine bessere Zukunft für die Kinder des Volkes mit funktionierenden Schultoiletten, geöffneten Bädern, sicheren Brücken, Aufhebung der Rückständigkeit der Dörfer, dem Glasfaserausbau usw. verspricht, ist ein Betrüger oder ein Mann, dessen Uhr 1899 stehen geblieben ist. Mit dem Jahrhundertwechsel um 1900 hob bekanntlich der Imperialismus an. Dass es zwischen dem Krieg des Kapitals gegen die Lohnarbeit und der Lohnarbeit gegen das Kapital keinen Mittelweg geben kann, ergibt sich schon aus der gegebenen Konstellation.
Der Philosoph Josef Dietzgen der Ältere, der unabhängig von Marx und Engels auf die materialistische Dialektik stieß, bezeichnete die idealistisch verbrämten bürgerlichen Professoren, die den Grundwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft leugneten, als diplomierte Lakaien der Pfarrei. Schließlich sprach Lenin 1909 im Empiriokritizismus vom Professorenscharlatanismus und von Gehirnen, die von der reaktionären Professorenphilosophie angefressen worden seien. Das Professorengesindel muss heute mit marxistisch-leninistischen Augen durchleuchtet werden, unter anderem immer unter der Voraussetzung, dass der Marxismus-Leninismus als inneren Lebensimpuls bzw. Kern dialektische Logik aufweist. Die Arbeiter und Kleinbauern dürfen sich nur nicht von Titeln blenden lassen. Fragt man die bürgerlichen Professoren nach Erfahrungen in der Produktionspraxis, so kommt nur sehr wenig rüber. Ihnen fehlt das entscheidende Kriterium der Praxis, deshalb sind die werktätigen Massen ihnen überlegen.
Materialistische Dialektik, davon ausgehend, dass es nur eine konkrete Wahrheit geben kann, arbeitet die Allseitigkeit der Beziehungen eines zu untersuchenden Gegenstandes heraus und versucht, jede Einseitigkeit in der wissenschaftlichen Untersuchung zu überwinden. Alle Grenzen in der Natur und in der Gesellschaft sind für sie bedingt und beweglich. Der Berufsrevolutionär muss versuchen, durch umfassende wissenschaftliche, tatsachenorientierte Arbeit alle Zusammenhänge zu erfassen, was nur anvisiert werden kann und niemals zu erreichen ist. Dieser Drang nach Allseitigkeit wird uns, so Lenin, vor Fehlern und vor Erstarrung bewahren.⁴
Die dialektische Logik verlangt, dass man an den Gegenstand nicht nur prozessual herangeht, ihn, wie Hegel manchmal sagte, in seiner Selbstbewegung, sondern in seiner ganzen Geschichte erfasst. Man muss sodann eingehen in die vollständige „Definition“ eines Gegenstandes, in die ganze menschliche Praxis sowohl als Kriterium der Wahrheit wie auch als praktische Determinante des Zusammenhangs eines Gegenstandes mit dem, was der Mensch braucht.⁵ Ferner gehen die Dialektiker davon aus, dass in der materiellen Wirklichkeit, in der Natur und in der Gesellschaft, der Kampf und die Einheit von Gegensätzen vorliegen, dass die Einheit der Gegensätze relativ, ihr Kampf aber absolut ist und dass die Gegensätze ineinander umschlagen können. In den Gesellschaftswissenschaften ist zum Beispiel der Klassenkampf Ausdruck der Einheit und des Kampfes der Gegensätze. Das sind nur einige Grundzüge der materialistischen Dialektik, die damit aber noch keineswegs erschöpft ist.
- Lenin: Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels, Werke, Band 19, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 550.
- Vergleiche Karl Marx: Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 27.
- Vergleiche Karl Marx, Friedrich Engls: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke, Band 4, Dietz Verlag Berlin, 196O, Seite 480.
- Vergleichegleiche Lenin: Noch einmal über die Gewerkschaften und die Fehler Bucharins und Trotzkis, Werke, Band 32, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 85.
- Vergleiche a. a. O.
Über den Autor:
Heinz Ahlreip, geb. am 28. Februar 1952 in Hildesheim. Von 1975 bis 1983 Studium in den Fächern Philosophie und Politik an der Leibniz Universität Hannover, Magisterabschluss mit der Arbeit »Die Dialektik der absoluten Freiheit in Hegels Phänomenologie des Geistes«. Forschungschwerpunkte: Französische Aufklärung, Jakobinismus, Französische Revolution, die politische Philosophie Kants und Hegels, Befreiungskriege gegen Napoleon, Marxismus-Leninismus, Oktoberrevolution, die Kontroverse Stalin – Trotzki über den Aufbau des Sozialismus in der UdSSR, die Epoche Stalins, insbesondere Stachanowbewegung und Moskauer Prozesse. Ahlreip arbeitete als Lagerarbeiter u. a. bei Continental in Hannover und bis zum Rentenbeginn als Gärtner für Museumsstätten und Friedhöfe.
.
Lest die Klassiker und studiert den Marxismus-Leninismus!
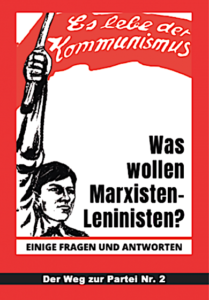 |
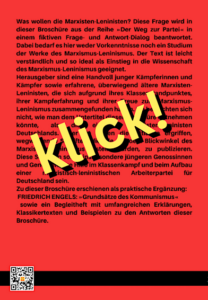 |
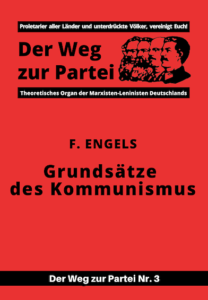 |
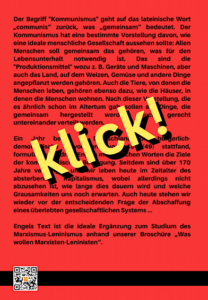 |
|
| bestellen | LESEPROBE | …. | bestellen | LESEPROBE |
.
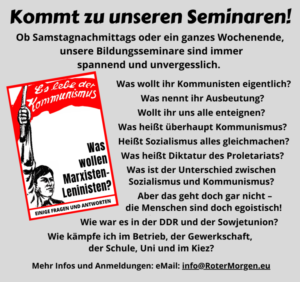 Kontakt: Info@RoterMorgen.eu
Kontakt: Info@RoterMorgen.eu
.
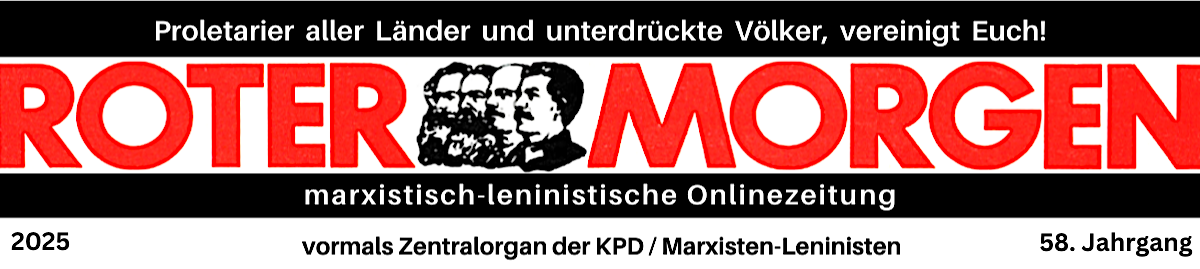

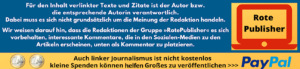
Antworten